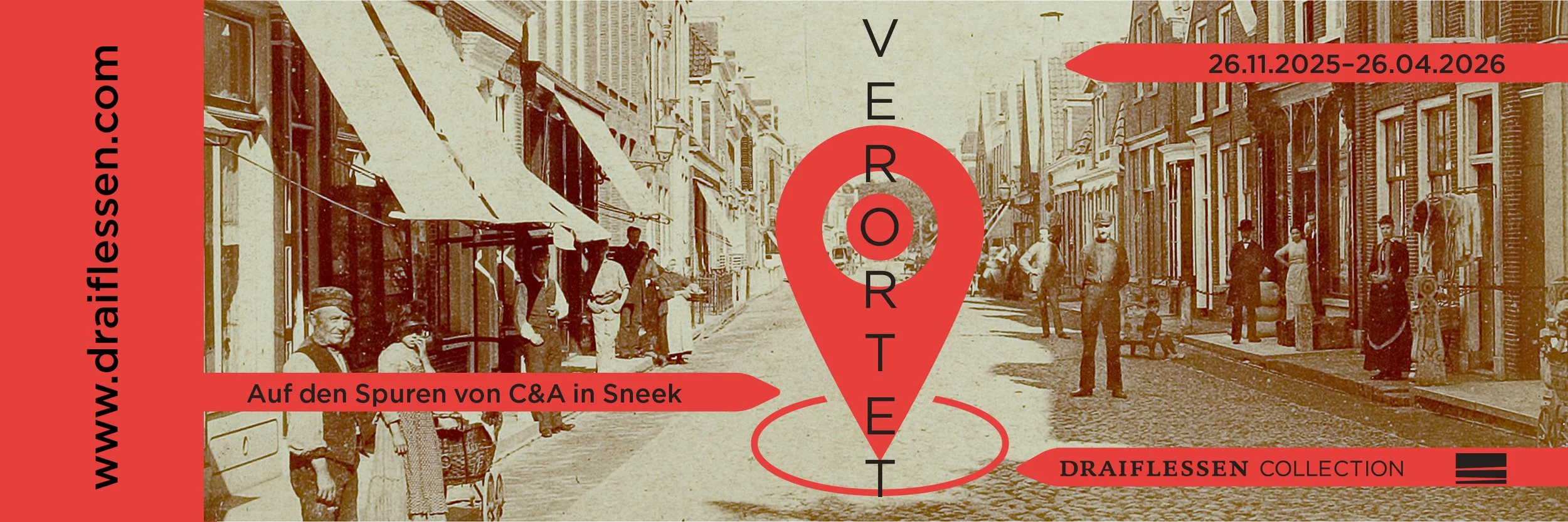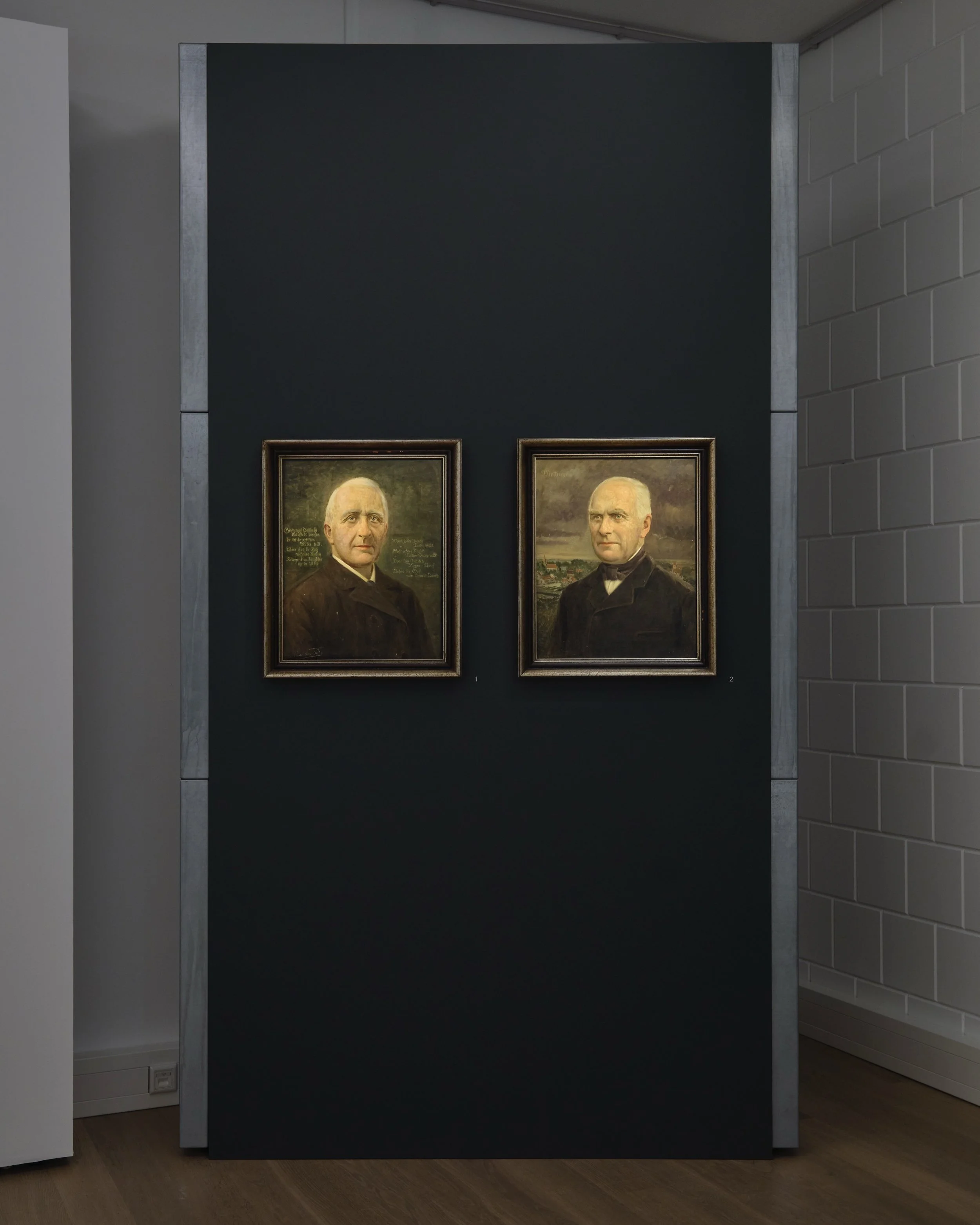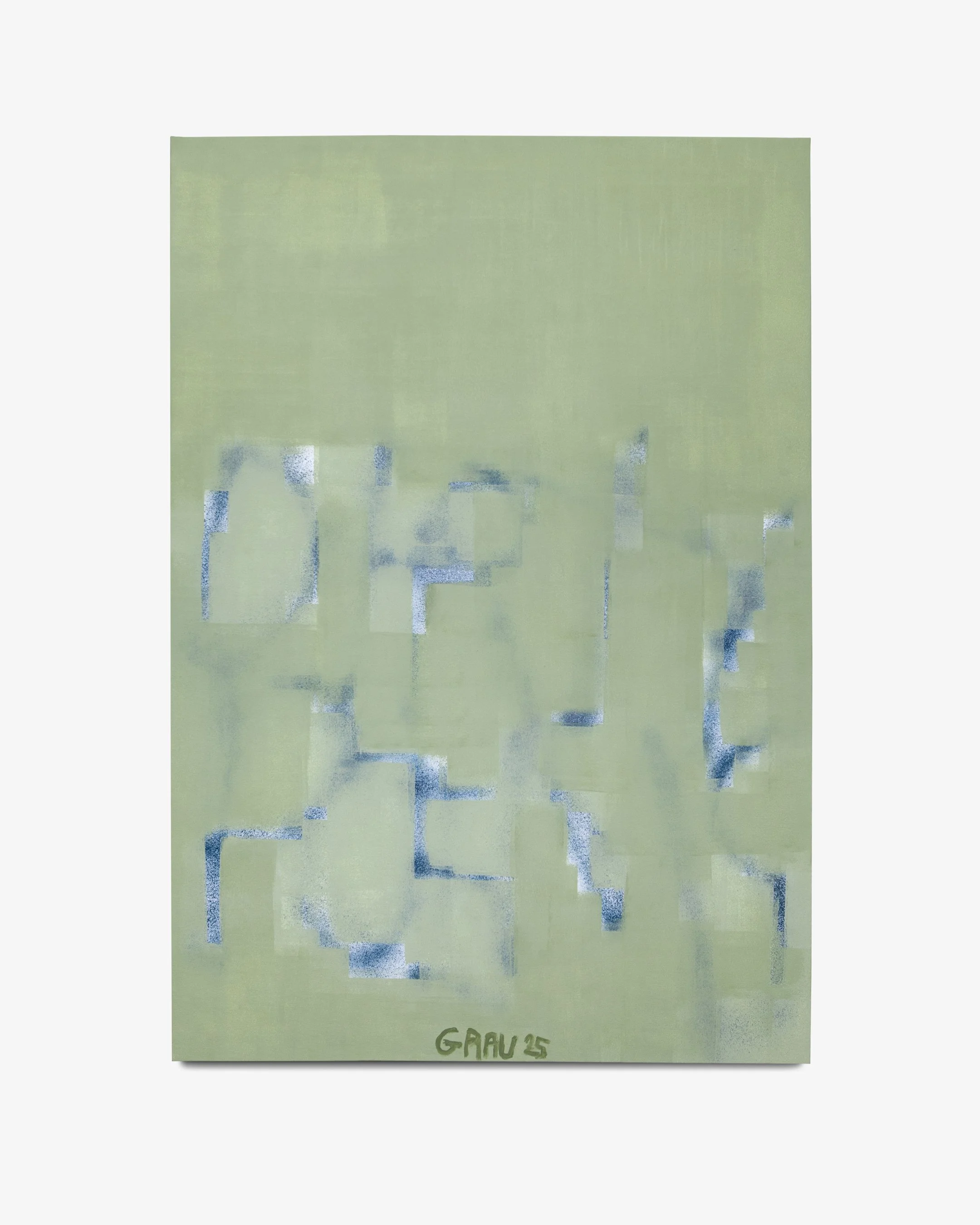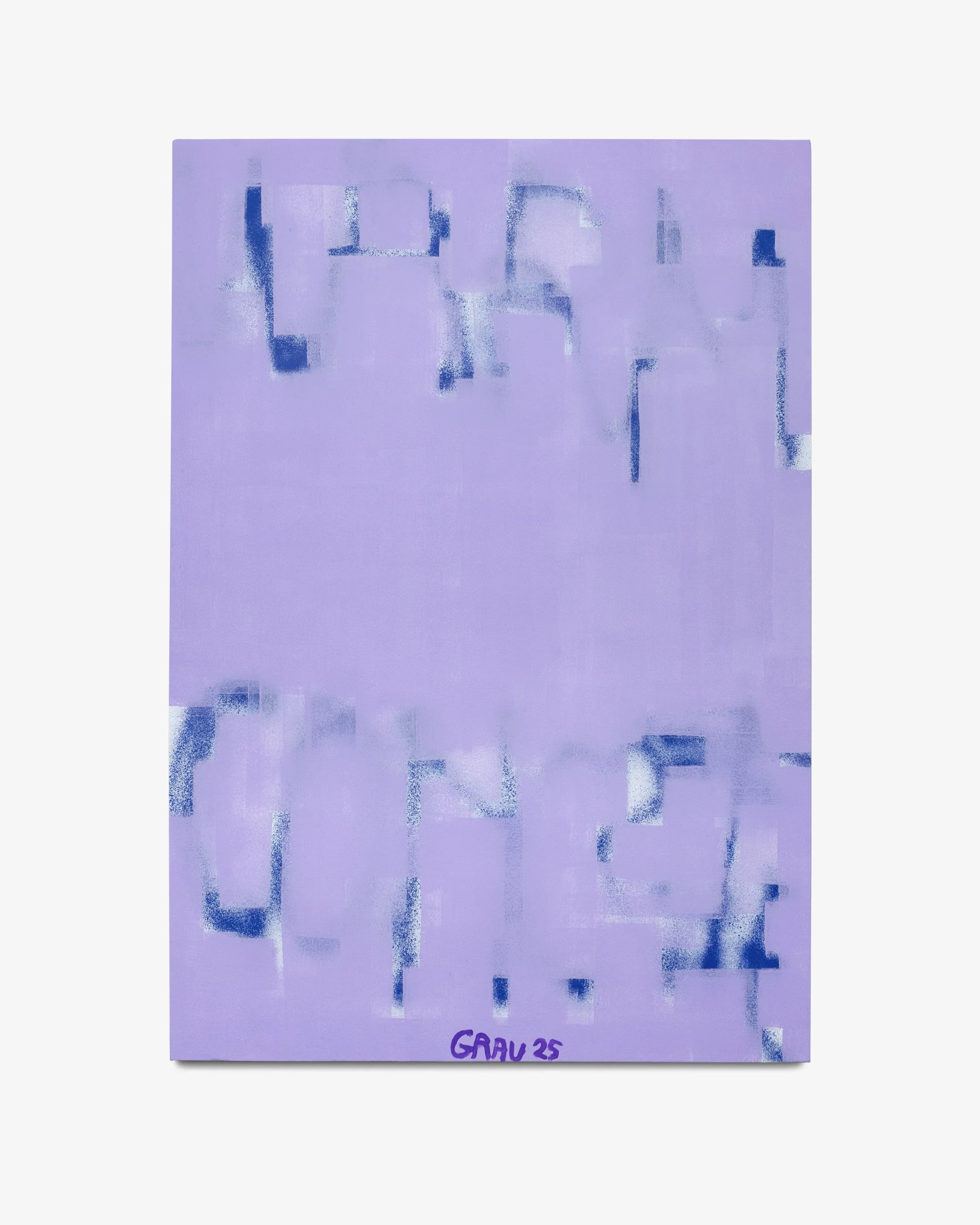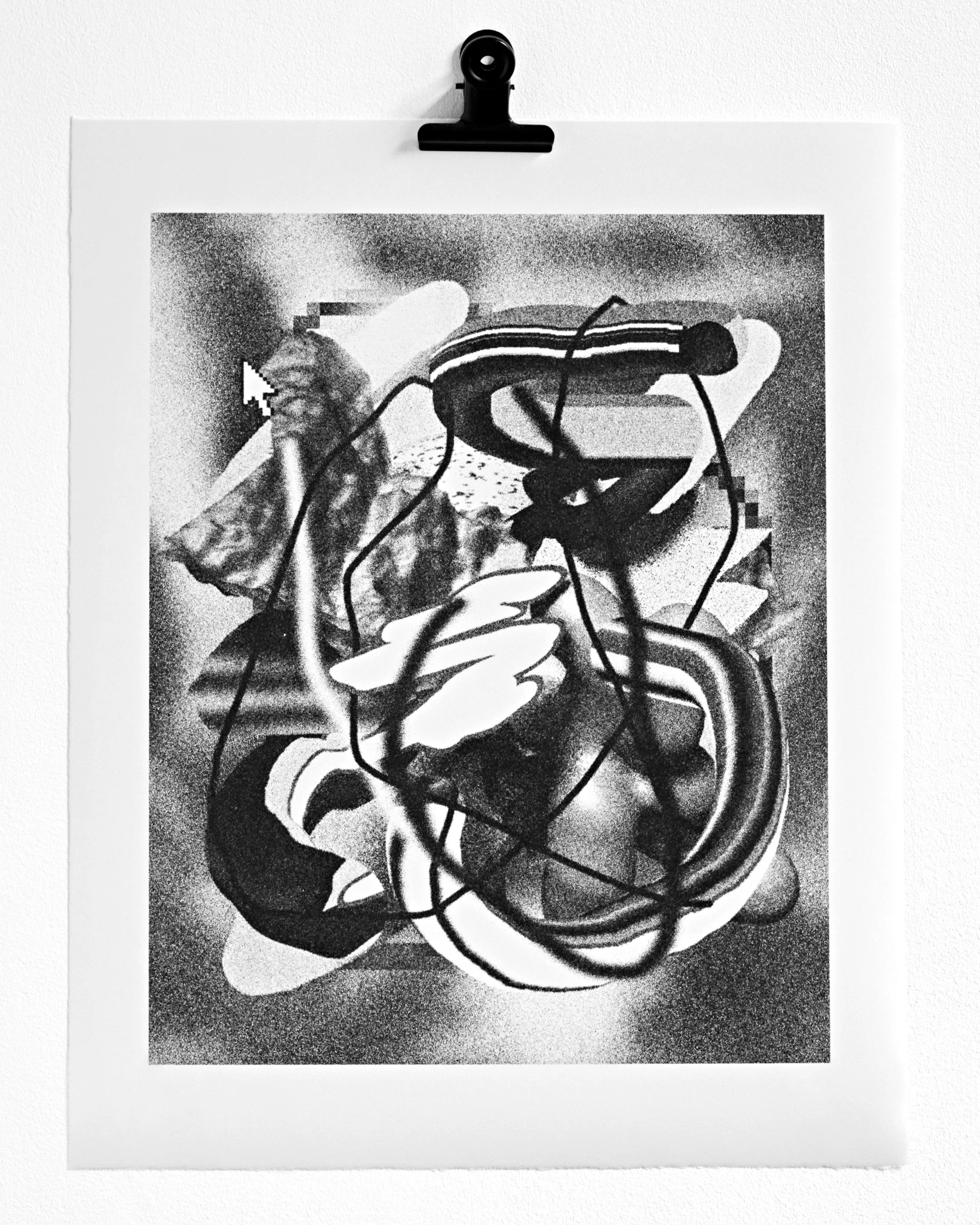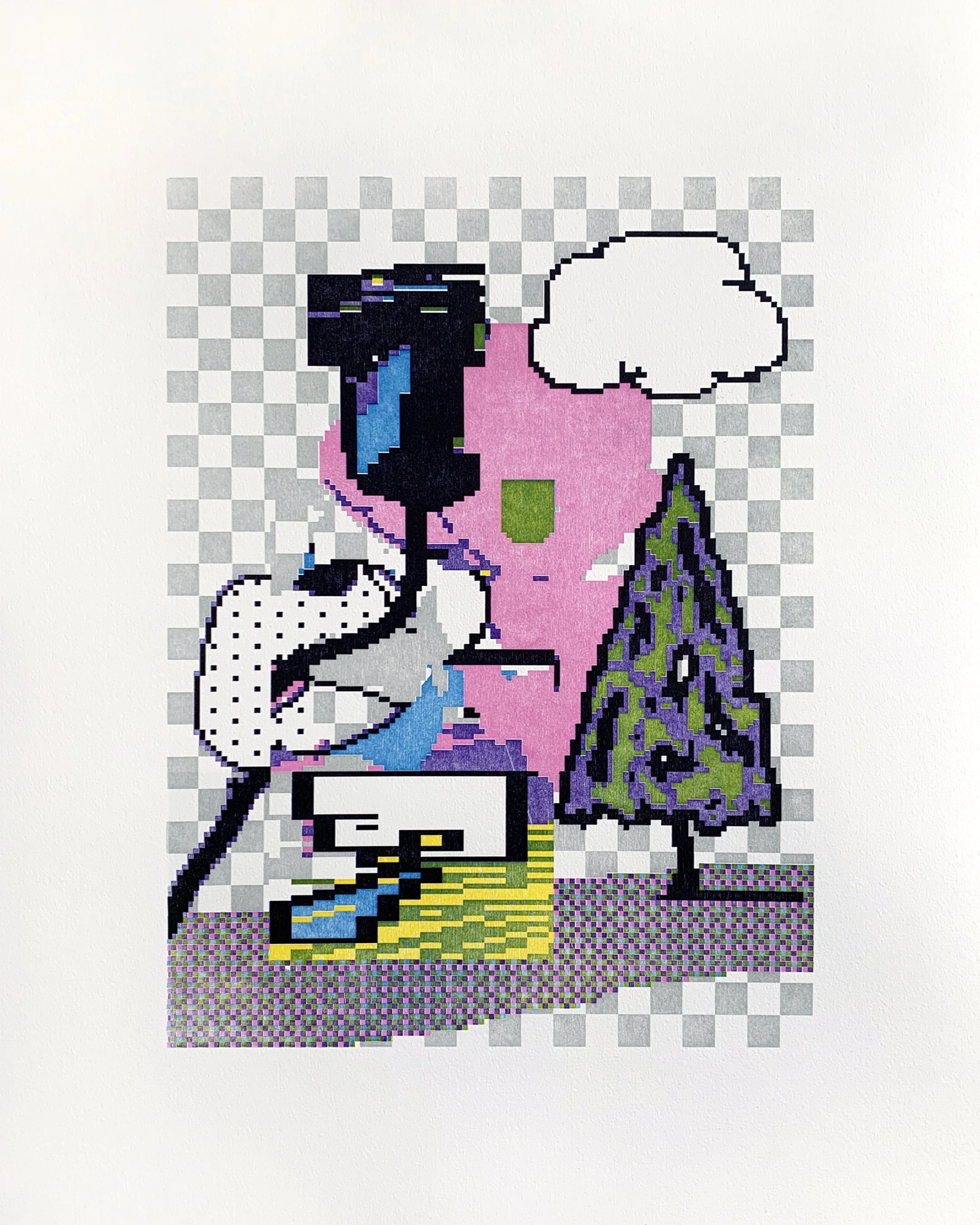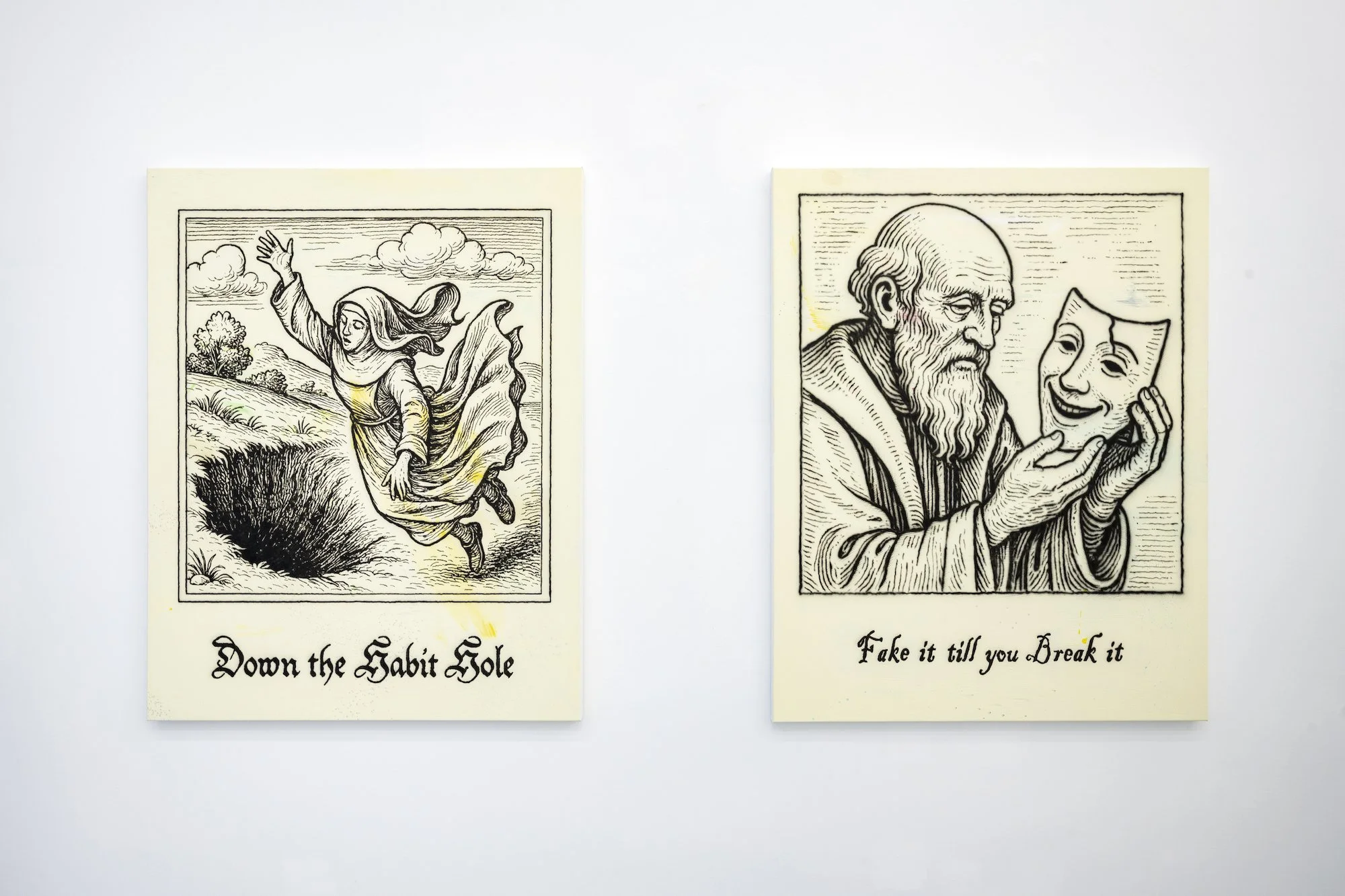



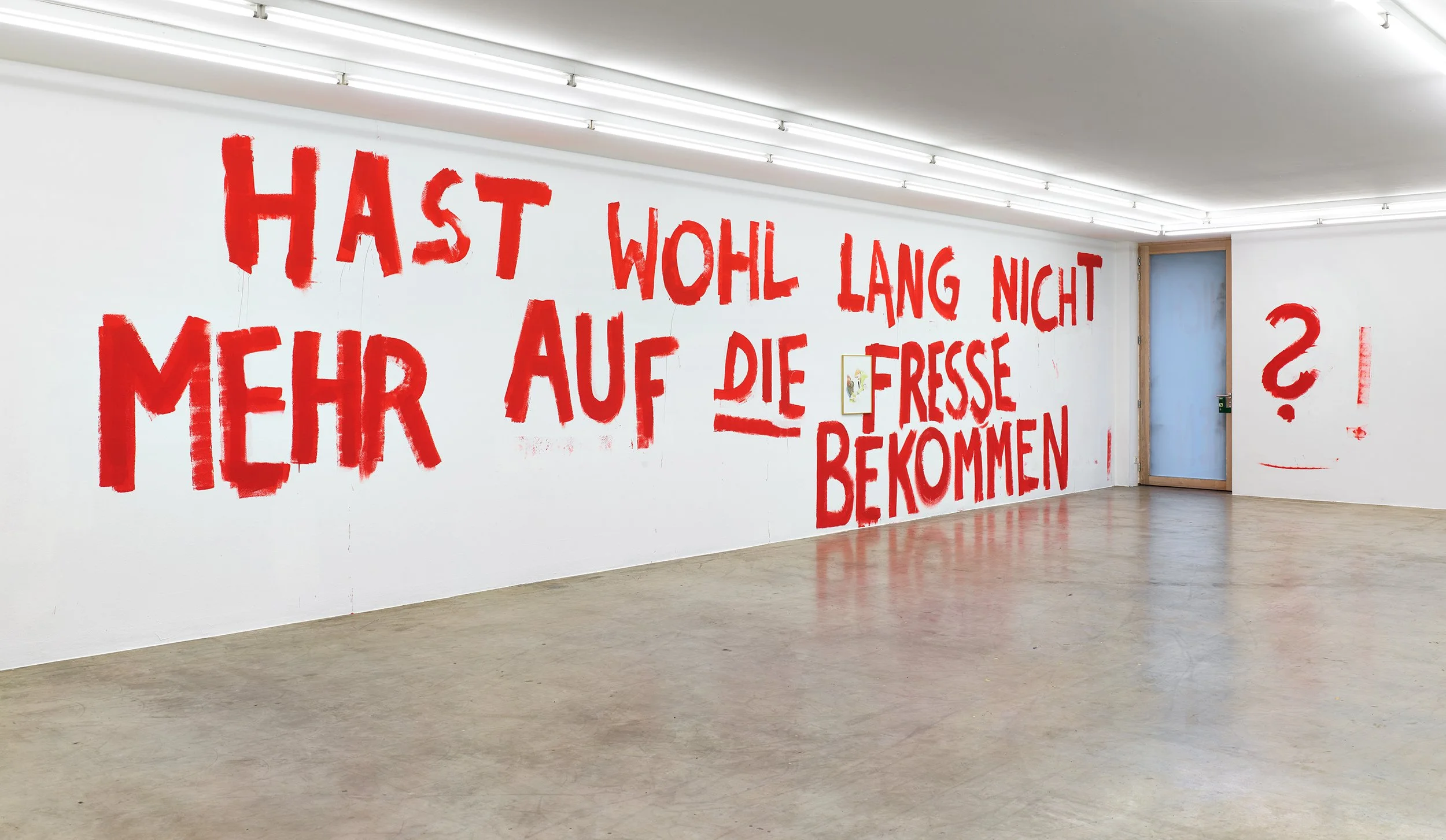















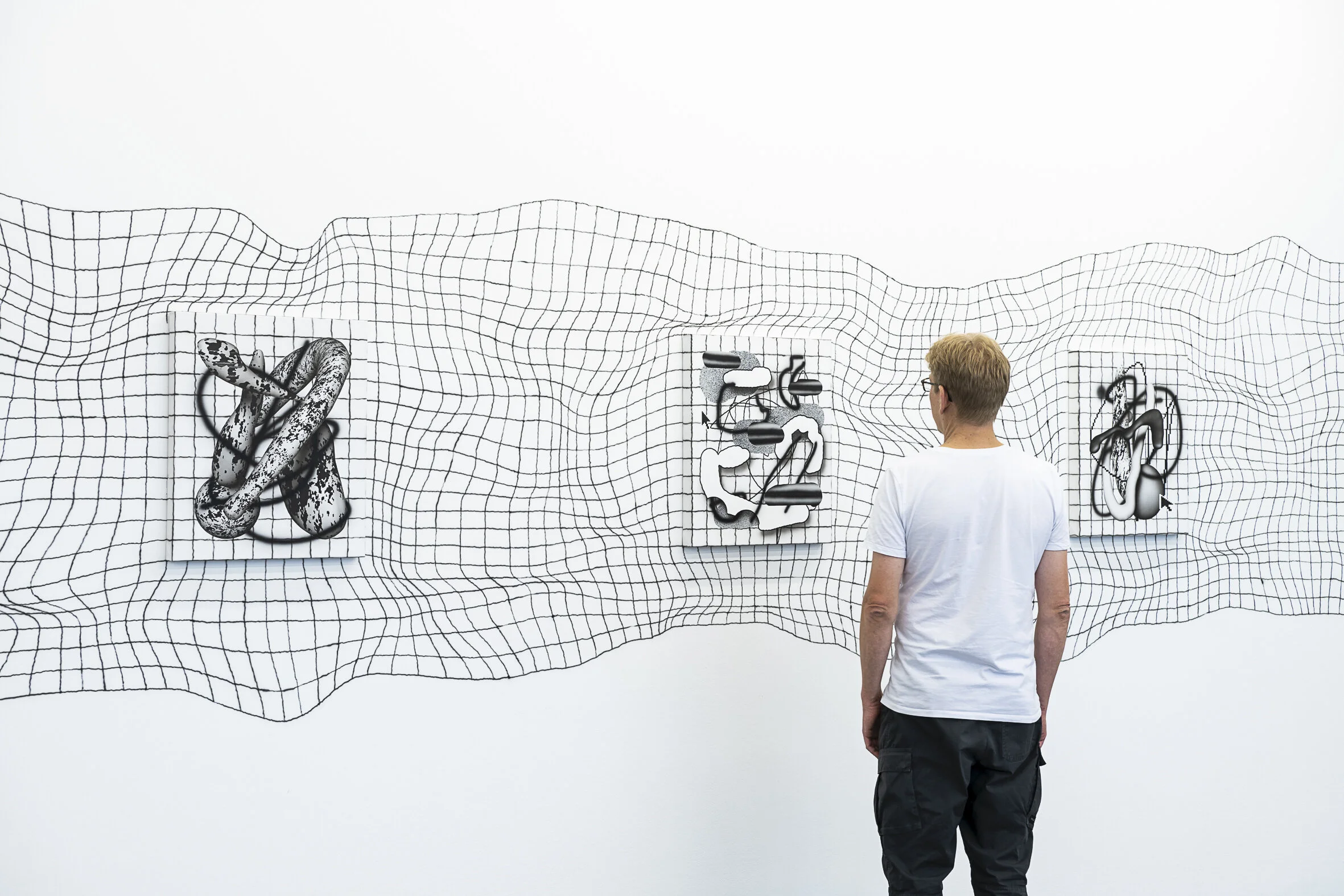




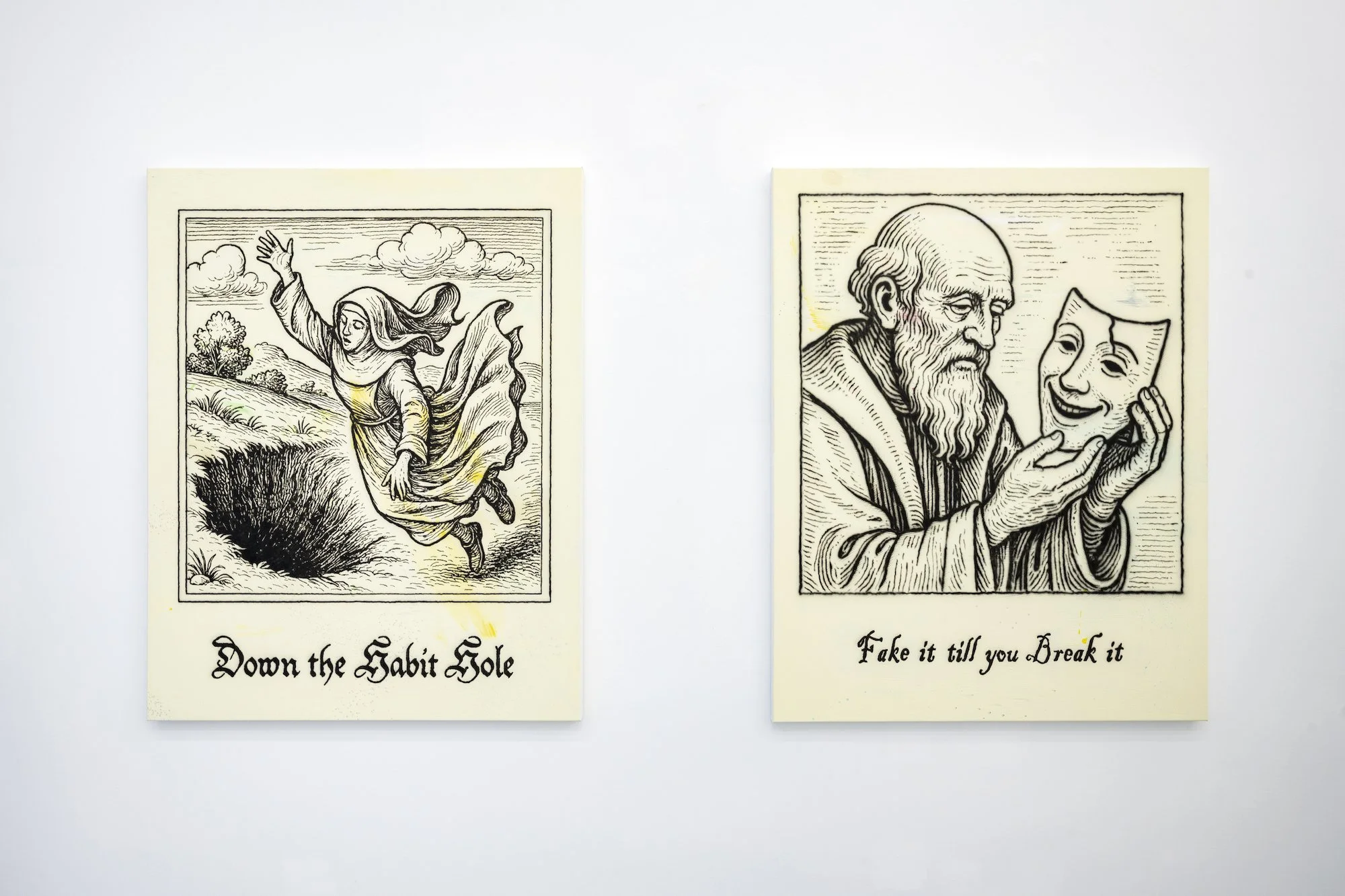



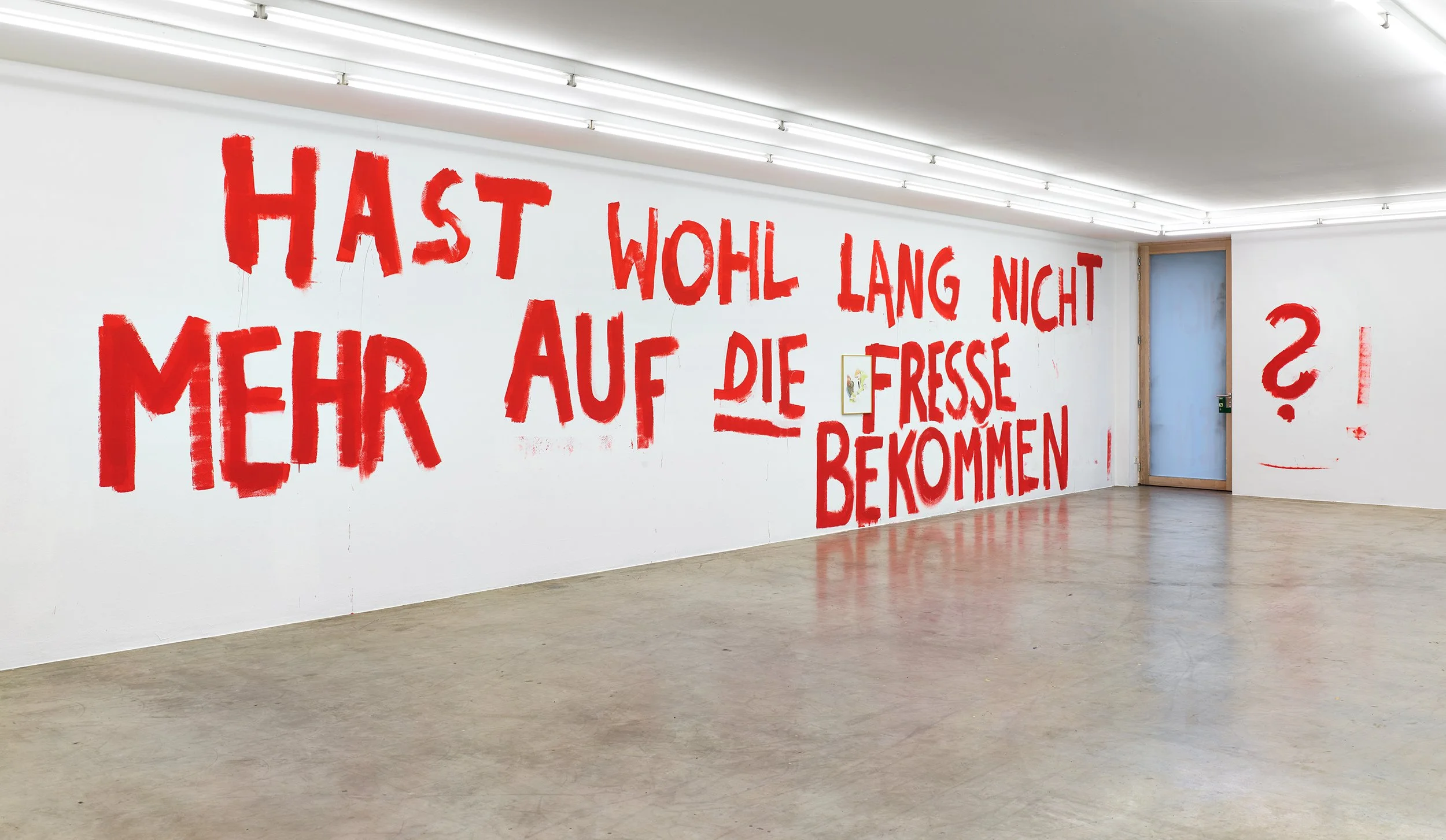















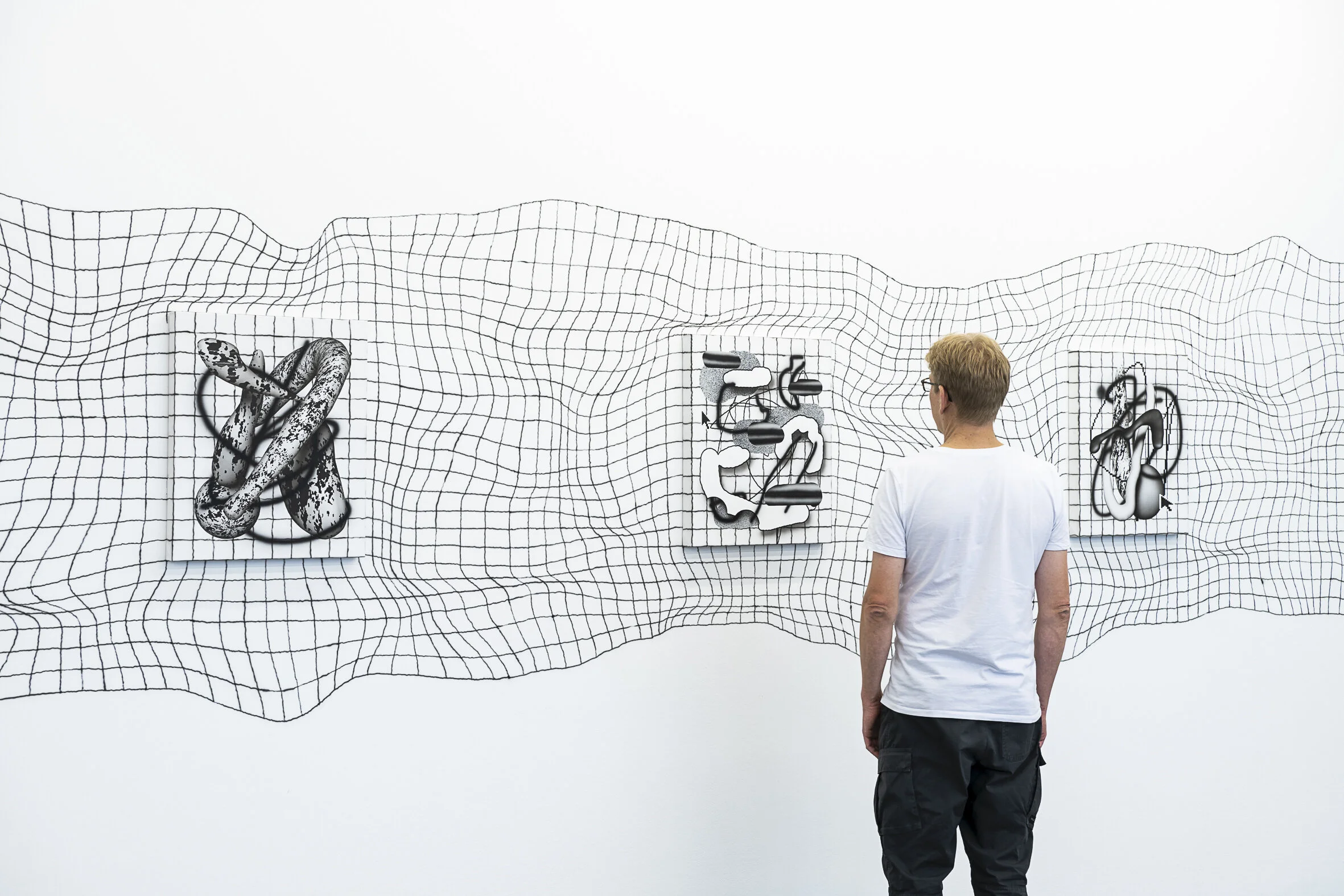

Wo Geschichte beginnt – C&A, Sneek und die Konstruktion eines Gründungsortes … Małgorzata Mirga-Tas – Textile Bilder einer verdrängten Geschichte … Raffael Bader: Zwischen Fläche und Gefühl … Wenn Magie zur Strategie wird – Künstlerinnen zwischen Ritual, Identität und Widerstand … Utopia. Recht auf Hoffnung – Kunst als Gegenentwurf zur Resignation …
Magazin

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Alte Fotos, neue Kunst – Sebastian Riemer über die Schönheit des Zufalls

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der Maler – Jan Holthoff im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Malerei mit Umwegen – Béla Pablo Janssen im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
I Like to See the Candle Burning at Both Ends – Ein Gespräch mit Jochen Mühlenbrink

Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Die Galeristen Daniel Schierke und Ralf Seinecke im Gespräch mit Ruth Polleit Riechert

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der Wurzler, der sich in Hörbüchern verliert – Ein Gespräch mit Johanna Flammer

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Form follows function – Ein Gespräch mit Morgaine Schäfer

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Was die Welt im Innersten zusammenhält – Angelika J. Trojnarski im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der Maler Daniel Heil – Ein Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Patrick Droste und Katharina Galladé, Geschäftsführer der Galerie Droste, im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Ruth Polleit Riechert

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Levente Szücs bringt zusammen, was nicht zusammengehört – Ein Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der stille Beobachter – Alwin Lay im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der Kölner Galerist Marco Alber im Gespräch mit Christoph Blank

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Die Kunstwelt ist kein Ponyhof – Ein Gespräch mit Katharina Klang, Direktorin der Sammlung Philara

Studio Visit
Christoph Blank
Studio Visit
Christoph Blank
Der menschliche Drucker – Arno Beck über das Wechselspiel zwischen Handgemachtem und Digitalem

Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Über die Interaktion mit dem Prozess - Sophie Heinrich im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Ruth Polleit Riechert

Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Bilder müssen in die Welt hinaus - Ruth Polleit Riechert im Gespräch mit Carolin Israel

Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Studio Visit
Ruth Polleit Riechert
Die Sucht nach Gespanntheit - Ruth Polleit Riechert im Gespräch mit Ryo Kinoshita
Studio Visit
Empfohlen
Artist Spotlight
Empfohlen
Art News
Empfohlen
Shop